Seiteninhalt
Systematik
Kl.: Haarwild > O: Schalenwild > UO: Wiederkäuer > F: Hirsche > UF: Echte Hirsche
Kennzeichen
- Gewicht:
- Hirschkalb bis 40 kg, Schmalspießer bis 70 kg, Hirsch bis 160 kg (aufgebrochen)
- Tierkalb bis 40 kg, Schmaltier bis 60 kg, Alttier bis 90 kg
- Drüsen: Tränengruben (gefüllt mit Hirschbezoar), Wedelorgan, Laufbürste
- Frisch gesetzte Lämmer wiegen bis zu 8 kg und haben 22 Zähne
- 34 Zähne (Grandeln im Oberkiefer)
Lebensweise
- Ursprünglich tagaktiv. Durch Jagddruck nachtaktiv geworden
- Lebt nicht territorial
- Feistzeit zwischen Verfegen und Brunft (Hirsch wird heimlich und frisst sich Energiereserven für die Brunft an)
- Suhlt gerne
- Mischäser, 5 – 8 Äsungsperioden pro Tag
- Im Winter Verkleinerung der Pansenoberfläche zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- Kolbenhirsche (Hirsche im Bastgeweih) tragen Rangstreitigkeiten mit den Vorderläufen aus
Rudel
- Kahlwildrudel: Auftreten ganzjährig, Alttiere, Schmaltiere, Kälber beiderlei Geschlechts, Schmalspießer. Immer von führendem Tier geleitet
- Hirschrudel: Auftreten außerhalb der Brunftzeit , wird vom jüngsten Hirsch geführt, bei Gefahr übernimmt der Älteste
- Brunftrudel: Auftreten zur Brunftzeit, Platzhirsch und Kahlwildrudel
Hirschgerechte Zeichen
- Typische Fährte
- Schrittlänge beim Hirsch ca. 70 cm (länger als beim Schwarzwild)
- Verhältnis von Ballen zu Schalenabdruck 1:3
- Vierballenzeichen: Mittelalter Hirsch. Ballen von Vorder- und Hinterlauf liegen nahezu aufeinander
- Übereilen: Abdruck des Hinterlaufs vor dem Vorderlauf bei jungen Hirschen
- Zurückbleiben: Abdruck des Vorderlaufs vor dem Hinterlauf bei alten Hirschen
- Beitritt: Abdruck des Hinterlaufs neben dem Vorderlauf
- Kreuztritt: Abdruck des Hinterlaufs teilweise im Abdruck des Vorderlaufs
- Schlosstritt: Trittsiegel im Bett des Hirsch, der durch Aufsetzten des Hinterlaufs unter dem Körper beim Hochwerden aus dem Bett entsteht
- Himmelszeichen: Durch das Geweih gewendete Blätter beim Durchziehen des Hirsches
- Losung: Hirsche Zapfen, Tiere Näpfchen (unbewiesen)
- Suhlen: Rotwild suhlt gerne
Lautäußerungen
- Kontaktlaut: Mahnen
- Warnlaut: Schrecken
- In Not: Klagen
- Brunftlaute: Schreien, Orgeln, Röhren, Trenzen, Knörren, Sprengruf
Fortpflanzung
- Brunft: September – Oktober
- Tragzeit: 34 Wochen (8,5 Monate)
- Setzzeit: Mai – Juni, Laufjunge folgen nach wenigen Tagen der Mutter
- Säugezeit: Bis zu 6 Monate
- Zuwachsrate: 70 – 80%
Rothirschgeweih
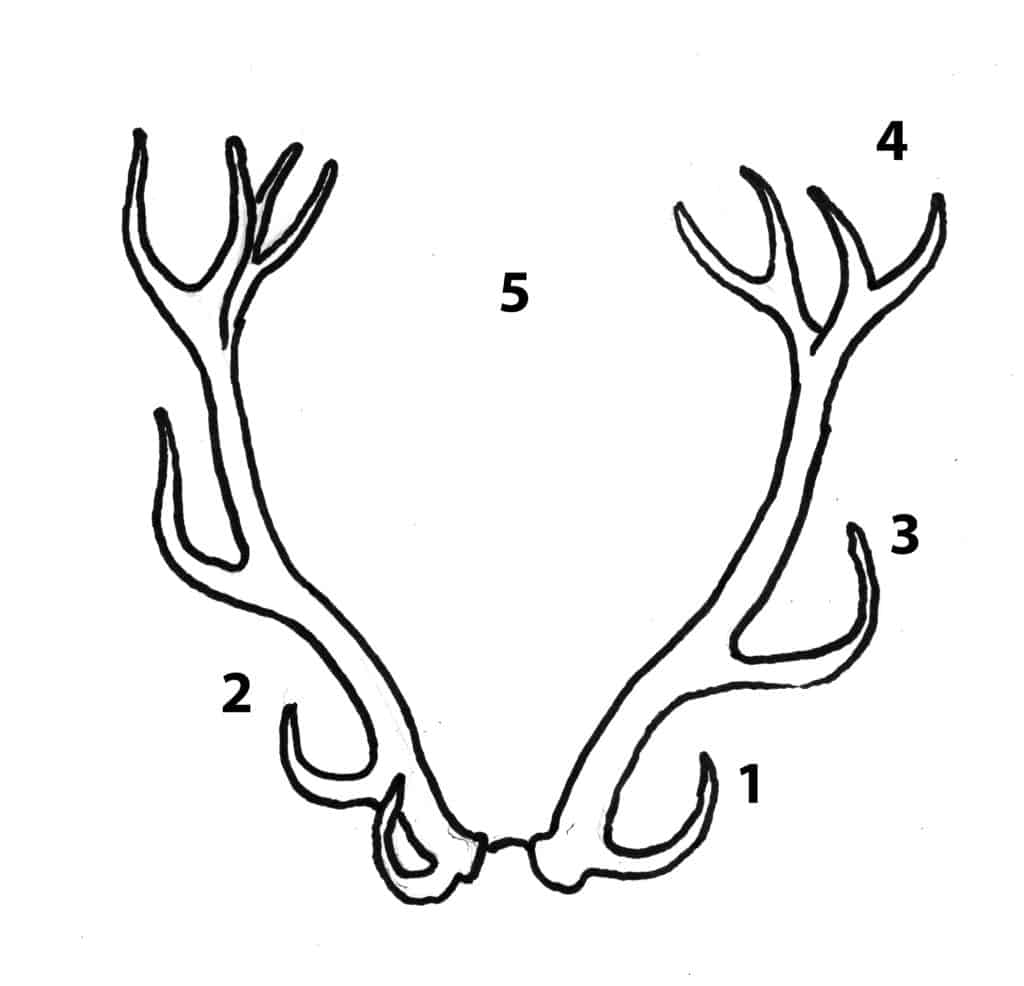
Bezeichnung
- Augsproß
- Eissproß
- Mittelsproß
- Krone
- Auslage
Erstlingsgeweih
- Bildung der Rosenstöcke: Februar – März (Ende des 1. LJ)
- Schieben des Erstlingsgeweihs: April – Juni (2. LJ aber Hirsch vom 1. Kopf) keine Rosen, Schmalspießer
- Fegen: September (2. LJ)
- Abwurf: April – Mai
Endgültiges Geweih
- Abwurf: Februar – März (alt vor jung)
- Fegen: Juli – August (alt vor jung)
Zahnentwicklung
| 6 Monate | M1 durchgebrochen |
| 18 Monate | M2 durchgebrochen |
| 24 Monate | P3 nun zweigipflig |
| 31 Monate | M3 durchgebrochen, Zahnentwicklung abgeschlossen |
Haarwechsel
- Sommerhaar auf Winterhaar: September – Oktober
Zeichen eines alten Hirsches
- Der Träger wird zunehmend waagerecht getragen
- Der Gewichtsmittelpunkt verlagert sich nach vorne
- Das Haupt wird bulliger
- Senkrücken
- Hängebauch
- Eine Hirschmähne besteht erst ab dem 4. Lebensjahr
Altersklassen und Abschussziel (Rotwildrichtlinien Schleswig-Holstein)
Männliches Rotwild:
Merken: 3 – 9
- Hirschkälber: 40 – 50 %
- Klasse III – Junge Hirsche (1-3 jährig): 30 – 35 %
- Klasse II – Mittelalte Hirsche (4-9 jährig): 5 – 10 %
- Klasse I – Alte Hirsche (10 Jahre und älter): 10 – 15 %
Kahlwild:
- Kälber: 35 – 45 %
- Schmaltiere (1 jährig): 10 – 20 %
- Alttiere (2 jährig und älter): 40 – 50 %







